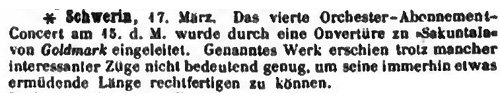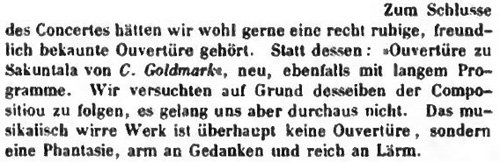Frisch und charakteristisch in der Erfindung
… dem ein guter Beifall zu Theil ward, obgleich sich auch ablehnende Stimmen geltend machten.« Auf diese wenigen Worte beschränkte das Fremden-Blatt vom 27. Dezember 1865 die Würdigung des ersten Orchesterwerkes, mit dem Carl Goldmark einen dauerhaften Erfolg erringen konnte: Seine Ouvertüre zu (oder nach) dem altindischen Drama Sakuntala, die die Wiener Philharmoniker im Herbst des Jahres»per Akklamation« zur Uraufführung angenommen hatten − dieses stimmungsvolle Werk bot dem Publikum und den kritischen Ohren der Fachleute endlich die vielen Schönheiten, die Goldmark bereits vor geraumer Zeit in Form einer Symphonie hatte liefern wollen. Der Erfolg war beachtlich, die Resonanz in der Presse durchweg positiv und überdies sehr erhellend, da verschiedene Referenten in ihren weitläufigen Abhandlungen ganz unverhohlen auf den schwelenden Konflikt zwischen absoluter und programmatischer Musik eingingen. Im Folgenden die besonders ausführlichen und markanten Texte:
In dem vierten »Philharmonischen Concert« […] wurde eine Ouvertüre, »Sakuntala«, von Karl Goldmark zum erstenmale aufgeführt und beifällig aufgenommen. Wir haben diese Composition in zwei Proben mit großem Interesse verfolgt und halten sie weitaus für das Beste, was der begabte und energisch vorwärtsstrebende Componist bisher geliefert hat. Frisch und charakteristisch in der Erfindung, von klarer Anlage und feinem Detail, zeigt die Ouvertüre eine entschiedene Klärung des früher etwas wirren und wühlenden Talentes Goldmark’s. Nur wenige Stellen erinnern an seine ehemalige Dissonanzen-Liebe und pathetische Unklarheit. Die wirksame, charakteristische Instrumentation verdient umsomehr Anerkennung, als Herr Goldmark bisher wol kaum in der Lage war, seine Orchestersachen selbst zu hören. Was das Verhältniß der Composition zu dem berühmten indischen Drama »Sakuntala« betrifft, so ist es kein abhängiges in dem, mißverständlichen Sinne der deskriptiven Musik. Als Musikstück an und für sich vollkommen verständlich und selbstständig, nimmt sie von dem Gegenstand nur die poetische Anregung, die allgemeine Stimmung und Localfarbe, allenfalls die einfachsten Grundzüge der dramatischen Peripetie. (Eduard Hanslick in: Neue Freie Presse vom 30. Dezember 1865)
***
Goldmarks Ouvertüre zu »Sakuntula« [sic!].
(R. H.) Der musikalische Schwerpunkt der abgelaufenen Woche war die erste Aufführung der neuen Orchesterouverture zu »Sakuntula« von Goldmark – im vierten philharmonischen Concerte am 26. December. Nachdem wir die Ouvertüre zwei Mal in der Probe und das dritte Mal im Concerte selbst vernommen, können wir nicht umhin unsere Freudigkeit über dieselbe rückhaltslos ausströmen zu lassen.
Goldmark lieferte mit diesem Orchesterwerk ein künstlerisches Product, das sich den besten dieser Art anreiht und dabei Selbstständigkeit genug besitzt, um als Original bezeichnet werden zu können, ein Umstand, den die wenigsten Orchesterouverturen neuester Factur in Anspruch nehmen dürfen, die entweder wohlausgeschrottete Capellmeistermusik sind oder die Firmen Mendelssohn-Schumann um ganze Bruchstücke plündern.
Goldmark nahm sich das altberühmte Gedicht indischen Ursprungs Sakuntula (auch Sakontala) zum Vorwurf, von dem schon unser größter deutscher Dichter beiläufig sagt, alle Süßigkeit und Minnigkeit, wolle er sie in ein Wort zusammenfassen, finde er in dem Begriff »Sakontala«. Goldmark, der sich bisher am liebsten in musikalischen Gewitternächten erging und dessen Phantasie nur Nachtschatten warf, versetzte uns heute in eine sternenhelle Sommernacht, welche die sanftesten, süßesten Melodien durchzittern. Sehr glücklich für den gewählten Vorwurf war die liebfreundliche Tonart F-dur, in deren verwandten Regionen sich der träumerische Componist heute mit außerordentlichem Geschick erging. Was bei dem Werk ganz eigenthümlich anzieht, ist die Einheitlichkeit des Ganzen; es ist ein klarer Fluß, ein durchsichtiger Erguß vom Anfang bis zum Ende. Die einzelnen Melodien fassen und lösen sich ab wie duftige Schlingpflanzen; es ist nirgends eine Macht sichtbar, alles quillt primitiv aus dem Innern hervor und athmet den tropischen exotischen Zauber, dem wir in alten Mährchen so gerne nachhangen. Dabei schwirren oder knistern die einzelnen Tonbilder nicht etwa schleuderhaft an uns vorüber, der Componist versteht es vielmehr, sie uns so recht inniglich an’s Herz zu legen, daß wir ihrem Wiederkommen freudig aufhorchen und daß wir ihnen folgen und gerne wieder folgen, auch wenn sie unter verschiedenen harmonischen Formen und Farben von uns Abschied nehmen, wie dies z. B. mit dem 3/4 Thema des Anfangs ganz zum Schlüsse auf die reizendste Weise geschieht. Die Instrumentirung des Werkes steht ganz auf der Höhe der Zeit, doch ist sie frei vor ihren Ausartungen. Wir wüßten nicht, daß der Componist irgendwo über sein Ziel griff, er versteht das edelste Maß zu halten und weiß damit ganz wunderschöne Wirkungen zu erreichen. Wir haben nicht gefunden, daß der Componist irgendwo an fremdes Gut rührte oder gar sich daran vergriffe; nur ein einziges Mal gemahnte uns eine Harmoniefolge an einen Wagner’schen Passus. Wohl der Sache, daß die Reminiscenz nur wie ein Flüstern ins Ohr drang!
Unser Orchester brachte die Ouvertüre durch eine meisterhafte, exacte Ausführung zur vollsten Geltung. Das Orchester mußte sich wiederholt erheben, auch der Dirigent Dessoff mußte persönlich wieder erscheinen, es war aufrichtiger Jubel aller Kunstkenner und Kunstfreunde, daher denn die paar abfälligen Zeichen beim Verhallen des Beifalls sich wie leere Nußschalen ausnahmen, die nach Aufhub einer prachtvollen Mahlzeit am Boden laut werden. Wir nennen es höchst abgeschmackt, Kunstgenüsse auf so triviale Weise abschwächen zu wollen; es hat überdies immer etwas anwiderndes, wenn die Ohnmacht sich zu verkünden versucht. Das Concert brachte des Weitern Glucks »Iphigenie«-Ouverture mit dem Wagner’schen Schluß, die A-dur- Arie aus der »Taurischen Iphigenie«, vielleicht die seelenvollste Arbeit Glucks, sehr entsprechend durch Herrn Walter vorgetragen, und zum Schluß Beethovens »Eroica«. In den Siegesjubel der Aufführung der Symphonie schmetterten heute rein und sicher, wie nie, die Hörner des Scherzo. Es war heute ein durch und durch unverkümmerter, freudiger Genuß, wie er in unseren Concerten immer seltener wird. (Wiener Zeitung vom 29.12.65)
***
***
… nun zu Goldmark’s neuer Ouverture, welche ihre poetischen Linien aus Kalidasa’s liebeglühendem Drama: »Sakuntala« schöpfte. In wie weit sich die Handlung des indischen Schauspiels in diesem Tonwerke abspiegelt, sei Jenen zu ermitteln überlassen, die zu derartigen Auslegungen Neigung und Muße haben. Uns kommt es zunächst auf den musikalischen Gehalt, auf die Stimmung und den Werth der Arbeit an, und nach allen diesen Richtungen ist Goldmark’s Ouverture als ein Werk zu bezeichnen, deren heute nicht eben gar zu viele geschaffen werden. Vor Allem ist die Erfindung frisch, oft bedeutend und nie alltäglich, häufig sogar von ganz ausgeprägter Originalität. Dazu gehört vornehmlich die Einleitung, deren Colorit immerhin als die Versinnlichung der berauschenden, üppigen Schwüle der tropischen Atmosphäre acceptirt werden kann. Wir finden die Erklärung dieser eigenthümlichen Farbe in der tiefen Tonlage und dem Vorwalten leerer Quinten. Das Hauptmotiv, ein lieblicher, in Triolen sich schaukelnder Gesang, überleitet in eine frische Fanfare, die allenfalls als die Jagd des Königs Duschmanta gelten kann. Nach einiger Durchführung dieser Motive tritt der Seitensatz ein, eine Art Verklärungsmusik mir Harfen und getheilten Geigen. Commentatoren mögen darin das Bild der schönen Sakuntala oder den Austausch der Liebeswonnen, die sie dem König und der König ihr einflößt, erkennen; wir erkennen die wirksame Steigerung des hier erklingenden Motivs, die Eigenthümlichkeit der Modulation mittelst Terzquart- und Secundenharmonien, die Durchsichtigkeit und den Wohlklang der Instrumentation an. Im weiteren Verlaufe verdüstert sich die Stimmung, der Satz wird wilder, drängender, es mengen sich schmerzliche Aufschreie in das immer mächtiger anschwellende Gebrause der Stimmen. Im höchsten Momente des tragischen Affects bricht der Satz ab und – beginnt von vorne.
Mag sich das Vorhergehende aus dem Ganze des Drama’s rechtfertigen lassen, mag es als das Vorgehen Sakuntala’s gegen die Götter, deren Fluch ihren Geliebten mit Wahnsinn schlägt, gedeutet werden, so fehlt uns für die genau wörtliche Wiederholung der Arbeit vom Anfange bis Ungefähr zur Mitte des bereits Gehörten alle Erklärung. Sie scheint uns weder formell nothwendig noch inhaltlich begründet. Auch der Prestozwischensatz vor dem jubelnden Massenschlusse dünkt uns, so wirksam er an und für sich ist und den Dur-Satz effektvoll vorbereitet, ein aus dem Rahmen der Form fallender Theil. Die Ouverture schließt glanzvoll und freudig, analog der Bedingung des indischen Drama’s, in welchem, im Gegensatze zum griechischen, der tragische Ausgang verpönt ist. – Alles in Allem ist Goldmark’s Ouverture *) eine Composition von nicht gewöhnlicher Bedeutung, die an und für sich, zumal aber nach der erfolgreichen Aufnahme, die ihr zu Theil geworden, ihren Weg in die große Weit nicht verfehlen dürfte. Mag immerhin Einzelnes daran auszusetzen sein, man fühlt sich doch freudig bewegt, wenn man dem schaffensarmen, dürren Zeitboden wieder einmal eine frische Blüthe entsprießen sieht. – Die Aufführung des Werkes lieferte rühmliches Zeugniß eingehender Sorgfalt, die dem Einstudieren desselben gewidmet worden war, denn es gibt da an technischen und sonstigen Vortragsschwierigkeiten nicht wenig zu bemeistern. (Blätter für Musik, Theater und Kunst vom 29. Dezember 1865)
* In Dunkel’s Musikalien=Verlag (Kohlmarkt) soeben in Partitur, zwei= und vierhändigem Clavierauszuge, erschienen.
***
***
Ed. K. Wie Buridan’s Thier zwischen zwei Bündeln Heu, so steht ein Orchesterkörper zwischen zwei Gattungen von Novitäten, nur mit dem Unterschiede, daß jene zwei Heubündel der Voraussetzung gemäß einander vollkommen gleich sein sollen, die beiden Gattungen von Novitäten hingegen, die wir im Auge haben, von einander sehr verschieden sind. In Wirklichkeit befindet sich ein Orchesterverein, der sich die Aufgabe stellt von Zeit zu Zeit etwas Neues zu bringen – und wer wollte ihm diese Aufgabe erlassen! – bei der Wahl von Novitäten in nicht geringer Verlegenheit. Bringt er eine Symphonie von der Sorte des »Columbus« [NB: von Johann Joseph Abert], wie sie im vorigen philharmonischen Concerte geboten worden ist, so muß er sich’s gefallen lassen, daß man dieselbe mit Gleichgiltigkeit aufnimmt, weil man dem Publikum nicht zumuthen kann, sich für Werk zu interessiren, welches durchaus unselbstständig uns nur längst bekannte Dinge erzählt, zumal wenn uns dieselben Dinge früher von Andern viel besser und nachdrücklicher erzählt worden sind. Entschließt sich ein solcher Kunstkörper aber einmal zu einer entscheidenden That und wagt es, etwas wirklich Neues zu bieten, etwa wie es vor zwei Jahren mit dem »Gretchen« aus der »Faust«-Symphonie von Franz Liszt, oder vor mehreren Kahren mit der »Faust«-Ouvertüre von Richard Wagner, oder mit symphonischen Werken von Hektor Berlioz der Fall war, so muß er sich wieder daraus gefaßt machen, daß die Originalität der Ausdrucksweise von Vielen für Bizarrerie, die ungewohnten Wendungen als barock angesehen werden können, weil man dem Publikum wiederum nicht zumuthen kann, für ein Werk, welches eine wirklich neue Sprache zu uns redet, beim ersten Hören sogleich das volle Verständniß und die liebevolle Hingabe, die zum Verständniß nöthig ist, mitzubringen. So erleben wir denn in der Regel das Schauspiel, daß eine Novität entweder gar keinen Eindruck hervorbringt, höchstens das Gesühl der Langweile, wie z. B. die neulich gehörte Ouverture von Hüttenbrenner oder daß dieselbe bei einem Theil des Publikums auf Opposition stößt und unter Zischen abgelehnt wird, während ein anderer Theil derselben seinen vollen Beifall schenkt, wie es im letzten philharmonischen Concert (am Stephanitage) der Ouverture zu »Sakuntala« von Carl Goldmark erging.
Goldmark ist in den Wiener musikalischen Kreisen keine unbekannte Persönlichkeit. Seit einigen Jahren ist in den Hellmesberger’schen Ouartett-Abenden zuerst ein Streich-Quartett, dann ein Quintett und endlich im vorigen Jahre eine Suite für Violine und Clavier aufgeführt worden. Alle diese Werke haben eine eigenthümliche Physiognomie, in allen zeigt sich eine selbstständige Individualität, in allen eine edle, durchaus noble Natur. Goldmark gehört zu jenen Talenten, von denen wir in unserem vorigen Musikbericht sagten, daß sie unfähig seien, etwas Gemeines, Triviales niederzuschreiben, daß aber ihre Erfindung keine sprudelnde sei. Goldmark ist nicht im Stande viel und rasch zu produciren, der Quell fließt nicht immer, aber wenn er fließt, beschenkt er uns immer mit einer erfreulichen Gabe. Wir freuen uns deßhalb recht herzlich, so oft wir Gelegenheit haben, eine Novität aus seiner Feder kennen zu lernen. Speciell der Ouverture zu »Sakuntala«, welche die Philharmoniker auf ihr classisches Programm gesetzt, haben wir mit Spannung entgegengesehen; denn wie sehr wir auch mit der Kammermusik Goldmark’s vertraut sind, ein Orchesterwerk haben wir von ihm noch nicht gehört und wir waren begierig zu erfahren, wie er das Orchester zu behandeln verstehe. Wir müssen bekennen, daß uns die Aufführung dieses Werkes eine wahre Freude bereitet hat. Die Themen sind zumeist von großer Durchsichtigkeit und Klarheit, so daß selbst beim ersten Hören das Nebeneinandergehen verschiedener Themen sofort verfolgt und verstanden werden kann. Wer nur einigermaßen im Hören geübt ist, wird die beiden nebeneinanderlaufenden Melodien, deren eine von getheilten Violoncelli’s und Clarinett, deren andere von den hinzutretenden Violinen durchgeführt wird, strenge auseinander zu halten im Stande sein und wird sich freuen, am jubelnden Schlüsse dieselben wieder in ganz anderer Färbung anzutreffen; denn hier übernehmen die Celli das frühere Violin-Thema, während sie ihr eigenes an die Hörner abgeben, welche dasselbe mit Macht und Kraft unisono in das ganze Tongewebe hineinschmettern. Die Art der Durchführung ist eine durchaus reife. Goldmark kennt das Orchester genau, er versteht es vortrefflich die Farben zu mischen, man sieht, daß er, was diesen Punkt betrifft, sich nicht umsonst an der Farbenpracht eines Liszt, eines Berlioz ergötzt hat.
Je mehr wir aber unsere Erwartungen – und diese waren keineswegs gering – befriedigt fanden, um so mehr mußten wir bedauern, daß ein Theil des Publicums sich der Novität gegenüber mit schroffer Kälte benahm und sie, wie schon gesagt, auszischte. Möge nun immerhin dem Publicum das Recht, seinen Beifall sowie sein Mißfallen durch laute Zeichen kundzugeben, unbenommen bleiben, uns veranlaßt diese Wahrnehmung zu einigen Bemerkungen, welche sich an dieselbe knüpfen lassen.
Goldmark’s Ouvertüre gehört in das Gebiet der Stimmungsmusik. Ihr Name »Sakuntala-Ouverture« trägt sicher dazu bei, schon von vornherein bei Vielen ein Vorurtheil gegen sich zu erwecken. Man hat hie und da etwas von Programm-Musik läuten gehört, die Programm-Musik, heißt es aber, ist keine eigentliche Musik, ihr eigentlicher Inhalt liegt außer ihr, und so wird denn nicht viel geprüft, sondern das Kindlein mit dem Bade verschüttet. Der ganze Streit über die Berechtigung der Programm-Musik läßt sich aber in wenigen Worten abthun. Ist ein Musikstück so geartet, daß kein Musiker es verstehen kann, und erst das Programm hinzutreten muß, um ihm das Verständniß zu vermitteln, so hat ein solches auf den Namen eines musikalischen Kunstwerks gewiß keinen Anspruch. Wenn aber ein Musikstück an sich, sowohl durch seine ihm innewohnenden musikalischen Gedanken, sowie durch die Art der thematischen Behandlung, durch seine harmonischen Wendungen, wie durch die Instrumentation auf das Gemüth des Hörers wirkt, so ist ein solches Tonstück ein rein musikalisches Kunstwerk, mag nun noch ein Programm hinzutreten oder nicht. Wer in einer Gemäldegalerie vor einem Bilde bewundernd weilt, der mag dann immerhin auch noch den Catalog öffnen und nachsehen, was das Bild noch sür Beziehungen aufweise, vor Allem wie es heiße: und mehr, als sich der Maler herausnimmt, wenn er den Namen seines Gemäldes angibt, erlaubt sich auch der Musiker nicht, der sein Werk »Pastoral-Symphonie“, »Gretchen«, »Romeo und Julie« oder »Sakuntala« nennt. Dem Musiker dieses Recht bestreiten zu wollen, scheint uns ein sehr engherziger Standpunkt zu sein. Wenn wir also behaupten, daß Goldmark’s »Sakuntala-Ouverture«gegen eine Voreingenommenheit zu kämpfen und deshalb einen schwierigen Stand hatte, glauben wir der Wahrheit sehr nahe gekommen zu sein. Capellmeister Dessoff dirigirte das Werk mit großer Sorgfalt und es erfreute sich einer wirklich liebevollen und vortrefflichen Aufführung. (Das Vaterland vom 29. Dezember 1865)